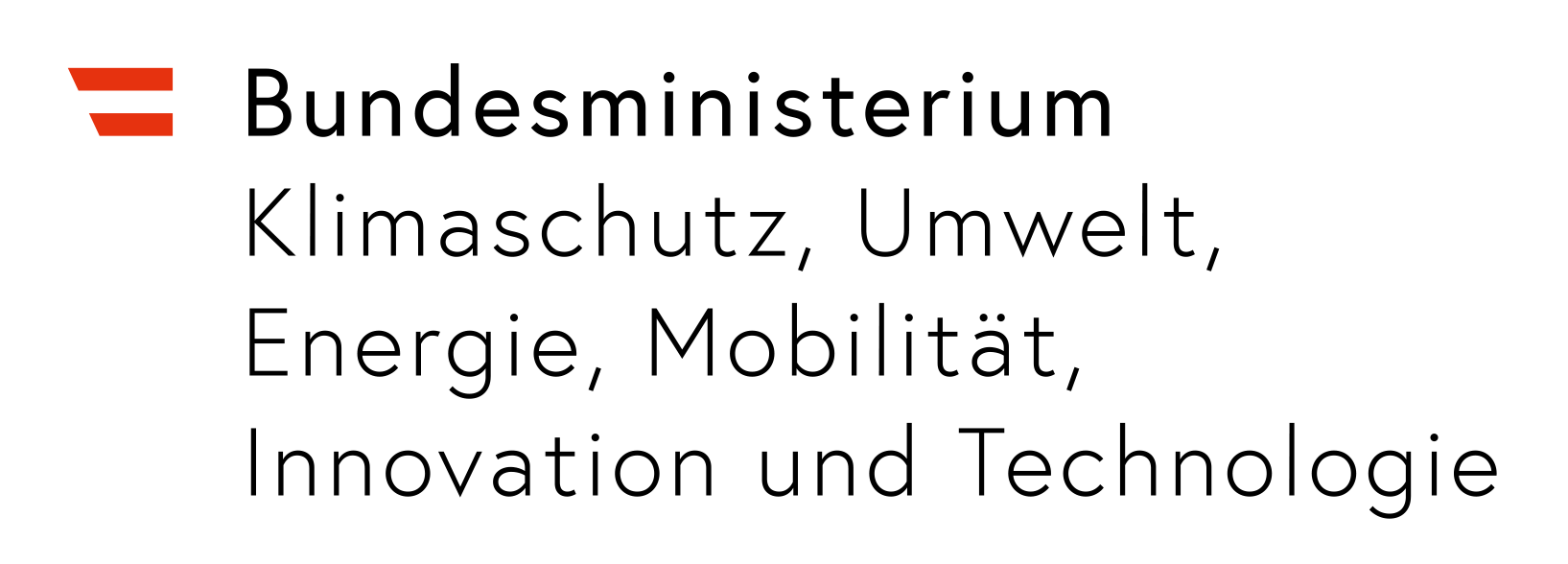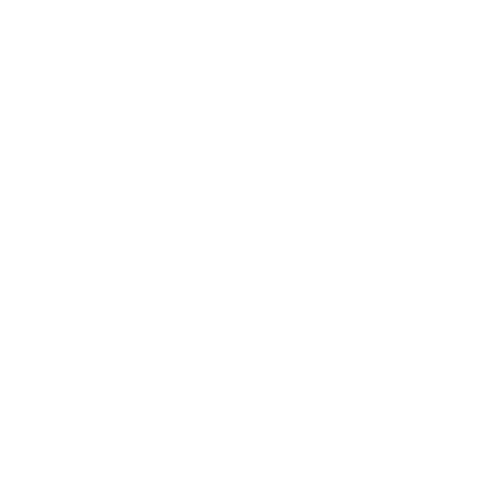Kategorie Innovation & Technologie - 22. Mai 2025
50 Jahre europäische Raumfahrt: Wie Weltraumforschung den Standort Österreich beflügelt
Studie belegt volkswirtschaftlichen Effekte der österreichischen Weltraum-Aktivitäten; Österreich erhöht den ESA-Beitrag auf bis zu 320 Mio. Euro für die kommenden Jahre
Vor 50 Jahren wurde die European Space Agency (ESA) mit dem Ziel gegründet, Europa technisch und politisch unabhängiger von den damals führenden Raumfahrtnationen USA und Sowjetunion zu machen. Obwohl sich seither geopolitisch vieles verändert hat, bleibt die Mission dieselbe: Europas Unabhängigkeit beim Zugang zum Weltraum und seiner Nutzung in einem sicheren Umfeld zu stärken und den Nutzen von Weltraumtechnologien und der Weltraumforschung für die Gesellschaft und eine wettbewerbsfähige sowie innovative EU-Wirtschaft zu maximieren.
Am 30. Mai 1975 wurde das Übereinkommen zur Gründung einer Europäischen Weltraumorganisation von zehn Staaten unterzeichnet: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Schweden, Schweiz und Spanien. Seitdem dient die ESA Europa als Raumfahrtagentur. Österreich kam 1987 als vollwertiges Mitglied dazu. Inzwischen ist die ESA auf 23 Mitgliedstaaten, zwei assoziierte Mitglieder und einen kooperierenden Staat angewachsen. Die ESA leistete in den vergangenen Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Weltraums.
Europa führend in der Erdbeobachtung
Die Erdbeobachtung via Satelliten ist dabei eines der europäischen Vorzeigeprojekte im All und Aushängeschild für Technologiehoheit des Kontinents. Über viele Jahre hinweg war dieses Feld auch das zentrale Forschungsgebiet von Josef Aschbacher. Inzwischen ist der Geophysiker Generaldirektor der ESA – der erste Österreicher in dieser Funktion, der nun alle Strippen der wichtigsten Projekte der europäischen Raumfahrt zieht. So etwa auch die strategisch wichtige Weiterentwicklung der europäischen Trägerrakete Ariane 6, die Europas unabhängigen Zugang zum Weltraum sichern soll, um weiterhin eigene Wissenschafts- und Kommunikationssatelliten ins All bringen zu können.
In Österreich spielt der Weltraumsektor nach wie vor eine zentrale Rolle als Motor für Innovation, aber auch wenn es darum geht, grüne Technologien sowie die Digitalisierung für den Standort voranzutreiben. Das Innovationsministerium (BMIMI) unterstützt den österreichischen Weltraumsektor auch über das nationale Weltraumprogramm, Austrian Space Applications Programme (ASAP) mit gezielten Förderungen. Bisher wurden über ASAP mehr als 800 Projekte unterstützt und sowohl Einnahmen aus EU-Projekten also auch Kooperationen mit Industrieunternehmen und Forschungsinstituten in anderen Ländern generiert. Dies trägt direkt zur Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie bei.
„In Österreich ist hier bereits vieles geglückt“, so Weltraumminister Peter Hanke anlässlich des anstehenden Jubiläums. „Der österreichische Weltraumsektor hat sich seit dem Beitritt zur ESA im Jahr 1985 nachhaltig als tragendes Mitglied der europäischen und internationalen Weltraumcommunity entwickelt.“ Österreichs Unternehmen und Forschungseinrichtungen haben in den letzten Jahren wichtige Kernkompetenzen aufgebaut und haben sich als enorm wichtige Zulieferer von Technologien, Produkten und Dienstleistungen etabliert. „Die Weltraumforschung ist also durchaus ein Stück weit eine Trägerrakete für den Standort Österreich“, so Hanke, dessen Anliegen es ist, dies auch mit der einer Industriestrategie 2035 mit gezielten Investitionen weiter zu stärken. „Durch eine Schwerpunktsetzung, macht es mein Ministerium möglich, Österreichs Beitrag bei der ESA-Ministerratskonferenz im November von 260 Millionen auf bis zu 320 Millionen Euro für die kommende Periode zu heben.“
Analyse belegt volkswirtschaftlichen Nutzen des Weltraumsektors
Der heimische Weltraumsektor besteht aus rund 150 Unternehmen mit rund 1.300 Beschäftigten und generiert nach Angaben von Austrospace, dem Verband der österreichischen Raumfahrtindustrie und Forschungseinrichtungen, einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro pro Jahr, wovon 75 Prozent direkt in Forschung und Entwicklung fließen. Wie auf europäischer und internationaler Ebene ist Weltraum auch in Österreich ein Hochtechnologiesektor. Das Engagement der Unternehmen in Forschung und Entwicklung ist mit 70-80 Prozent der Vollzeitäquivalente sehr hoch. „Jeder Euro ist hier gut investiert, denn wir eine aktuelle Analyse vom Economica Institut für Wirtschaftsforschung belegt, hat die österreichische Weltraumwirtschaft einen hohe Bruttowertschöpfung. 2024 belief sich diese auf 198 Mio. Euro“, so Hanke.
Mehr zum Thema Weltraum und Forschung gibt es übrigens im Sommer zu erleben, wenn Wien zur „Space City“ wird. Von 24. bis 26. Juni 2025 findet im Rahmen des Living Planet Symposiums der ESA und veranstaltet von BMIMI und UIV Urban Innovation Vienna, am Karlsplatz unter dem Motto „Space in the City“ ein Weltraum-Festival mit einer interaktiven Entdeckungsreise statt.
Ob Virtual-Reality-Raketenflug, Satellitenbilder zum Anfassen oder der Klang von Wien aus dem Weltraum: Drei Tage lang wird bei freiem Eintritt erlebbar, wie Daten aus dem All dabei helfen, das Leben auf der Erde nachhaltiger zu gestalten.
#OE1 feiert mit uns 50 Jahre 🇪🇺 Raumfahrt & hat den 22. Mai kurzerhand zum Ö1 Space Day erkoren – ein Tag lang ganz im Zeichen des @esa.int Jubiläums mit Sendungen zu Gegenwart & Zukunft der EU Raumfahrt & einem wieder mal hervorragenden Radiokolleg, jetzt schon zum Nachhören: bit.ly/OE1SpaceDay 👈
— Bundesministerium für Innovation, Mobilität & Infrastruktur (@bmimi.gv.at) 21. Mai 2025 um 10:04
Eine kurze Geschichte der Weltraumforschung in Österreich
1529 bis 1556: Der Wiener Militärtechniker Conrad Haas beschreibt in einem Buch die damals bekannten Einsatzgebiete der Raketentechnik (etwa Feuerwerk und Waffen) und widmet sich Detailfragen des Raketenbaus, verschiedenen Raketentypen (Studien zu einer Mehrstufenrakete) und Treibstoffgemischen (u.a. Flüssigtreibstoff).
7. August 1912: Der Physiker Viktor Franz Heß entdeckt bei Ballonaufstiegen die Kosmische Strahlung, die er noch Höhenstrahlung nennt. 1936 erhält er dafür den Physik-Nobelpreis.
1923: Der Physiker Hermann Oberth, der als Begründer der wissenschaftlichen Raketentechnik gilt, veröffentlicht seine Dissertation Die Rakete zu den Planetenräumen. 1929 folgt das Werk Die Wege zur Raumschiffahrt, in denen er fast jedes Raumfahrtkonzept beschreibt, das bis dato verwirklicht wurde.
1924: Der gebürtige Bozener Max Valier veröffentlicht das Buch Der Vorstoß in den Weltenraum. Ab 1928 entwickelt er gemeinsam mit Fritz von Opel Raketenantriebe u.a. für Autos. Valier stirbt am 17. Mai 1930 durch die Explosion einer Brennkammer auf dem Prüfstand und gilt als erstes Opfer der Raumfahrt.
1926: Der Wiener Chemiker Franz von Hoefft und der Maschinenbauer Guido von Pirquet gründen 1926 die erste raumfahrtbezogene Gesellschaft in Westeuropa, die Wissenschaftliche Gesellschaft für Höhenforschung in Wien. Hoefft war Spezialist für Raketentreibstoffe und schlug ein Programm zur Raketenentwicklung vor. Pirquet veröffentlicht 1928 sein Buch Die Möglichkeiten der Weltraumfahrt und berechnet Antriebe einer Marsrakete sowie Flugbahnen zur Venus.
1931: Der oberösterreichische Techniker Friedrich Schmiedl startet seine Versuchsrakete 7, die 102 Briefe aus Schöckl bei Graz in ein Dorf in fünf Kilometer Entfernung transportiert. Seine Idee: Eine Raketenpost zwischen Gebirgsdörfern oder zwischen den großen Hauptstädten der Welt. In Wien wird die Österreichische Gesellschaft für Raketentechnik gegründet.
1932: Der Ingenieur Eugen Sänger eröffnet an der Technischen Hochschule Wien einen Prüfstand für Raketentriebwerke. Seine Dissertation über „Raketenflugtechnik“ wird 1929 abgelehnt, sein 1933 erschienenes Buch wird eines der Standardwerke der Raumfahrtliteratur.
1947: Umfangreiche Aktivitäten im Bereich Ionosphärenphysik am Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Graz.
50er Jahre: Forschungsarbeiten im Bereich Plasmaphysik im Weltraum am Institut für Theoretische Physik der Universität Innsbruck
1954: In Innsbruck findet 5. Kongress der Internationalen Astronautischen Föderation (IAF) statt.
1961-1964: Beteiligung Österreichs an der Schaffung einer Europäischen Raumfahrtagentur (Comité Préparatoire des Recherches Spatiales –COPERS).
1966: Konferenz des internationalen Komitees für Weltraumforschung (COSPAR) in Wien.
1968: Mit UNISPACE I kommt die erste UNO Weltraumkonferenz nach Wien.
seit 1969: Entwicklung und Bau von Instrumenten für die Erforschung des Weltalls und zur Satellitenkommunikation am Institut für Nachrichtentechnik und Wellenausbreitung der Technischen Universität Graz.
1970: Gründung des Instituts für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)
1972: Gründung der Austrian Space Agency (ASA).
seit 1975: Beteiligung Österreichs an Programmen der European Space Agency (ESA)
1975: Erste europäische Weltraum-Sommerschule in Alpbach, Tirol, die seither alljährlich abgehalten wird.
1977: Sitzung des UNO-Komitees zur friedlichen Nutzung des Weltraums (COPUOS) in Wien
1981: Assoziierte Mitgliedschaft Österreichs bei der ESA
1982: Erste Beteiligung des IWF der ÖAW an sowjetischen Planetensonden (Venus-Sonden Venera 13 & 14). UNISPACE II – UNO Weltraumkonferenz in Wien.
1983: Erster Flug des europäischen Weltraumlabors SPACELAB mit dem in Österreich entwickelten Weltraumfenster und drei österreichischen Experimenten.
1986: 37. IAF-Kongreß in Innsbruck (Wahl des ASA-Geschäftsführers Johannes Ortner zum Präsidenten der IAF für die Periode 1986-1988).
1987: Österreich wird Vollmitglied bei der ESA
1991: Die legendäre AUSTROMIR-Mission, Flug des österreichischen Kosmonauten Franz Viehböck zur russischen Raumstation MIR samt Durchführung zahlreicher Experimente.
1993: Übersiedlung des Weltraumbüros der Vereinten Nationen von New York nach Wien.
1996: Abhaltung der Sommerkurse der Internationalen Weltraumuniversität (ISU) in Wien.
1999: UNISPACE III – UNO Weltraumkonferenz in Wien.
2002: Start des Österreichischen Weltraumprogramms, einer Initiative des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, Programmträgerschaft durch die Austrian Space Agency – in weiterer Folge wickelt die ASA die Programme ASAP, ARTIST, TAKE-OFF sowie die Österreichische Nano-Initiative im Auftrag des BMVIT ab.
2003: Gründung des Europäischen Instituts für Weltraumpolitik ESPI in Wien.
2004: Forschungsreform und Gründung der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG, Eingliederung der Austrian Space Agency als Agentur für Luft- und Raumfahrt (ALR) in die FFG.
2011: Abhaltung der Sommerkurse der Internationalen Weltraumuniversität (ISU) in Graz.
2012: Österreichisches Weltraumgesetz tritt in Kraft.
2013: Start der ersten Österreichischen Satelliten (Vermessung von Helligkeitsschwankungen von Sternen mit bisher nicht erreichter Genauigkeit).
2014: ALR-Chef Harald Posch wird Vorsitzender des ESA-Rates.
2015: Start der NASA-Mission MMS. Die Magnetospheric Multiscale Mission (MMS) untersucht die Dynamik des Erdmagnetfeldes und die zugrundeliegenden Energietransferprozesse – dies geschieht mit der Hilfe von vier Satelliten, die es erlauben, dreidimensionale Messungen zu machen. Das Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist der größte nicht-US Partner bei dieser Mission und beteiligt sich an den Messungen der elektrischen und magnetischen Felder.
2016: Ein österreichisches Büro der ESERO-Initiative wird im Auftrag von ESA und BMVIT im Ars Electronica Center Linz eingerichtet. Das European Space Education Resource Office ist ein Projekt der ESA und mit Bildungspartnern in europäischen Ländern zur Förderung des Interesse der Jugend an naturwissenschaftlichen Fragestellungen aktiv.
Der Österreicher Josef Aschbacher wird ESA-Direktor für Erdbeobachtung.
2017: Jubiläum 30 Jahre Österreich bei der ESA. Mit Pegasus wird der dritte österreichische Satellit ins All geschickt.
2018: Aufbruch zum Merkur: Start der Mission BepiColombo mit High-Tech & Know-how aus Österreich an Bord. Die heimische Weltraumindustrie ist an BepiColombo maßgeblich beteiligt und konnte dafür Aufträge in Millionenhöhe an Land ziehen.
ESA-Wettersatelliten mit Sensoren aus Graz fliegen ins All. Am Satelliten GK-2A ist das Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mit einem sogenannten Vier-Sensoren-Magnetometer (SOSMAG) beteiligt.
2019: Die künftige Weltraumstation Lunar Gateway wird mit Austro-Technik ausgestattet. Launch des im Auftrag der ESA an der TU Graz entwickelten Nanosatelliten OPS-SAT. Zum ersten Mal findet das World Space Forum in Wien statt.
2021: Josef Aschbacher wird als erster Österreicher am 1. März 2021 Generaldirektor der ESA.
2023: Österreichischer Mini-Klimasatellit PRETTY erfolgreich ins All gestartet.
2024: Das ESA-Phi-Lab Austria wird als Weltraumtechnik-Hub in Wien-Schwechat eröffnet.
Die neue Ariane-6-Rakete startet erfolgreich ins All, mehrere Firmen aus Österreich sind beteiligt.