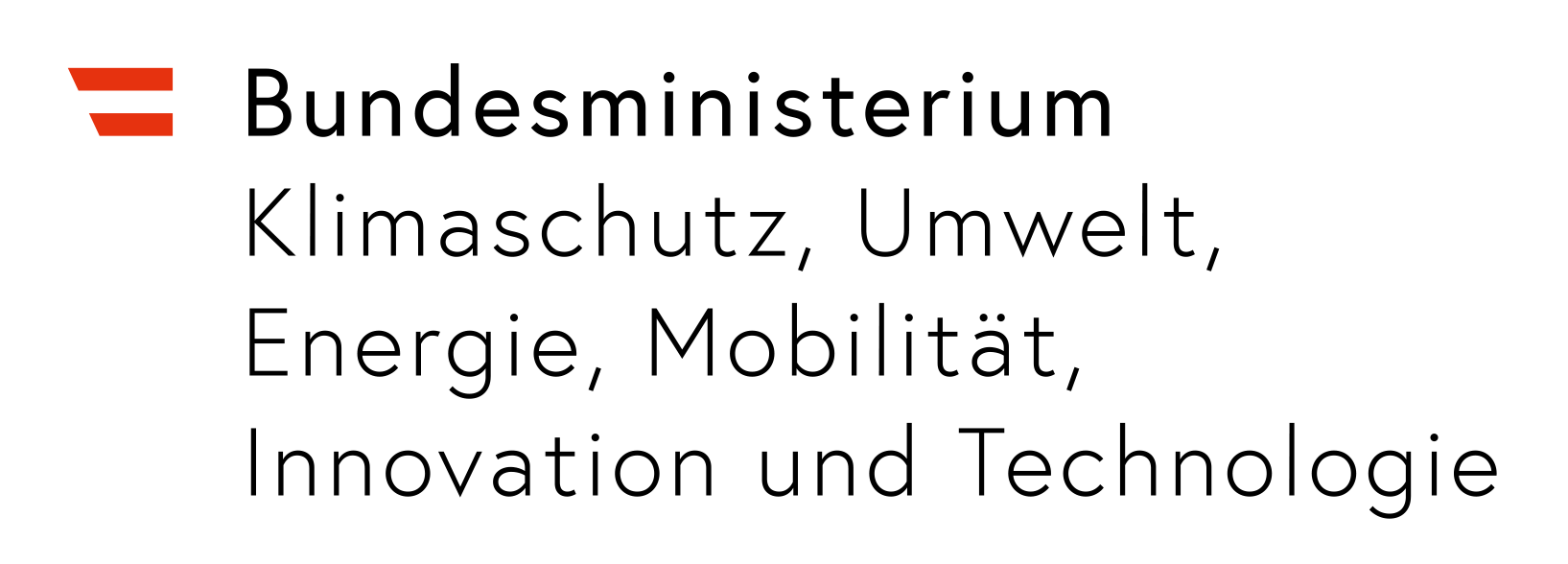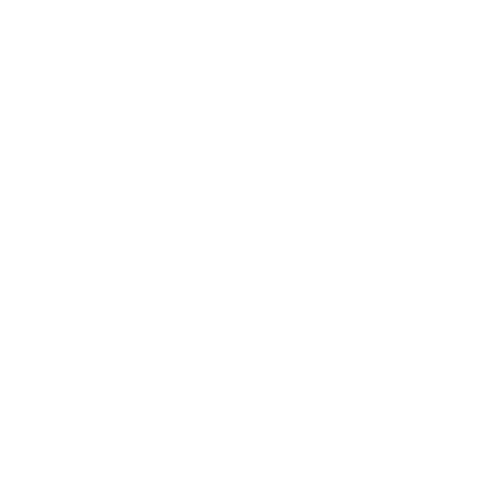Kategorie Mobilität - 23. April 2025
Das gefährliche Abkuppeln von Güterwaggons soll bald Geschichte sein
Viele Komponenten im Zugverkehr sind bewährt, aber auch seit Jahrzehnten unangetastet. In Europa wollen Bahnbetreiber endlich das Kuppeln digitalisieren
Die erste Eisenbahnstrecke der Welt wurde im September 1825 zwischen den englischen Orten Stockton und Darlington eröffnet. Seit damals begleiten zahlreiche technologische Fortschritte die 200-jährige Geschichte des längst nicht mehr dampfenden Dampfrosses. Mit einer bemerkenswerten Einschränkung: Im Güterverkehr setzen europäische Bahnbetreiber nach wie vor auf die klassische Schraubenkupplung als Verbindungstechnik zwischen den Waggons. Diese ist zwar bewährt, in der Verwendung jedoch zeitaufwendig und für das Personal nicht ungefährlich. Weltweit sind zwar verschiedene mechanisch-automatische Kupplungen im Einsatz, die bei Kontakt selbstständig eine Verbindung zwischen Zugteilen herstellen – nur eben nicht in Europa.
Mehrere europäische Forschungsprojekte wollen diesem Zustand ein Ende setzen. Allen voran DAC4EU, ein Konsortium, das über das Programm Mobilität der Zukunft des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) gefördert wird. Beteiligt an dem Forschungsprojekt sind unter anderem auch die Rail Cargo Austria sowie die Schweizer Güterbahn SBB Cargo. Das Ziel der Branche ist die sogenannte digitale automatische Kupplung (DAK), die weit über das Funktionsspektrum gegenwärtiger mechanisch-automatischer Kupplungen hinausgehen soll. Die DAK soll nämlich nicht nur die Wagen selbst automatisch miteinander kuppeln, sondern darüber hinaus Strom, Druckluft und sogar Datenleitungen.
Bremsprobe digitalisieren
„Die DAK ist wesentlich für die Digitalisierung und Automatisierung im Verschub, bei der Zugbildung und Zugvorbereitung, sowohl generell im Wagenladungsverkehr auf der Schiene als auch bei der Integration in zukunftsfähige intermodale Logistiksysteme“, erklärt Karl Zöchmeister vom Stab Unternehmensentwicklung der ÖBB Infrastruktur. Er ist Leiter des von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG geförderten Projekts DACIO (Digital Automatic Coupling in Infrastructure Operations). Es wurde Ende März nach einer Laufzeit von 3,5 Jahren abgeschlossen. Acht akademische und Wirtschaftspartner beschäftigten sich dabei mit möglichen Auswirkungen einer künftigen Einführung der DAK auf die Abläufe in Verschiebebahnhöfen.
Die Automatisierung der Prozesse beim Verschub ist auch ein Schwerpunktthema an der Fachhochschule Oberösterreich, einem der Projektpartner in DACIO. „Die Einführung der DAK wäre ein Riesensprung“, sagt Burkhard Stadlmann, Leiter der Forschungsgruppe Bahnautomatisierung an der FH. „Weil durch die automatische Anbindung von Strom und Daten gäbe es sehr viele Digitalisierungsmöglichkeiten, die derzeit nicht oder nur rudimentär vorhanden sind. Und es könnten auch viele Prozesse automatisiert werden.“
Ein Beispiel ist die Bremsprobe, in deren Rahmen die Funktionstüchtigkeit des Bremssystems kontrolliert wird. Ein anderes ist die Überprüfung auf Vollständigkeit während der Zugfahrt, mit der sichergestellt wird, dass kein Waggon „verloren“ gegangen ist, also etwa aufgrund eines mechanischen Defekts unbeabsichtigt vom Zug abkuppelt. Durch den Einsatz von Sensoren ergäben sich darüber hinaus praktische Anwendungen wie permanente Zustandskontrollen der einzelnen Waggons beziehungsweise ihrer Ladung.
Waggons verschieben
Im Speziellen haben die Oberösterreicher die Möglichkeiten beim sogenanten Rollbergverschub in Verschiebebahnhöfen untersucht. Dabei werden die einzelnen Waggons, die später unterschiedlichen Zügen zugefügt werden sollen, von einer Verschublok einen künstlich angelegten Hügel, den Rollberg, hochgeschoben. Sobald sie den höchsten Punkt des Hügels passiert haben, rollen die Wagen aufgrund der Schwerkraft selbstständig bergab und werden von Weichen auf das jeweils vorgesehene Richtungsgleis geleitet. Hier werden sie dann von im Gleiskörper verbauten Bremselementen abgebremst. Sobald alle für einen Zugverband vorgesehenen Wagen vorhanden sind, wird die Lok angekuppelt und der Zug fährt zu seiner jeweiligen Destination. Aufgrund der hohen Anzahl von Kupplungsvorgängen ist dieser Prozess mit den herkömmlichen Schraubenkupplungen besonders mühsam und für das Personal nicht ungefährlich.
Die Forschenden der FH Oberösterreich haben deshalb ein Gerät entwickelt, das den jeweils heranrollenden Waggon auf einem Richtungsgleis automatisch abbremst und mit dem Waggon davor kuppelt. Zusätzlich kann es auch die Strom- und Druckluftversorgung und eine allfällig vorhandene Datenleitung kuppeln und sogar eine Bremsprobe durchführen. Das Gerät mit der Bezeichnung „FDFT Preparator“ (für „Full Digital Freight Train“) wurde gemeinsam mit dem niederösterreichischen Maschinenbauunternehmen Ulbrich entwickelt. Es ist absenkbar in einer etwa acht Meter langen Grube in das Gleis integriert.
Das massive Teil ist dafür ausgelegt, bis zu 400 Tonnen schwere Waggons mit einer Geschwindigkeit von zwei Meter pro Sekunde auf einem drei Meter langen Bremsweg abzustoppen. Mit dem Preparator dauert das Zusammenstellen der einzelnen Waggons zu einem Zug samt der nötigen Überprüfungen etwa 15 Minuten, sagt Stadlmann. Mit herkömmlicher Technik seien es mehre Stunden. „Der größte Vorteil ist der Zeitgewinn“, erklärt der Wissenschafter. „Zweitens die Kostenersparnis. Und drittens der Sicherheitsgewinn. Weil wenn kein Personal mehr zwischen den Wagen herumklettern muss, fällt eine große Gefahrenquelle weg.“ Ein Prototyp des Preparators ist aktuell im ÖBB-Bildungscampus in St. Pölten verbaut. In künftigen Projekten zur DAK soll er dann im realen Betrieb in einem Verschiebebahnhof getestet werden.
Raimund Lang, Der Standard
Mit der Digitalen Automatischen Kupplung (DAK) werden manuelle Tätigkeiten beim Kupplungsvorgang automatisiert und die Güterwagen mit Energie- und Datenleitungen versorgt. Dadurch ist es möglich Betriebsprozesse zu digitalisieren, moderne Instandhaltungsmethoden zu nutzen und eine Vielzahl an innovativen Applikationen für Endkunden anzubieten. Bereits im vergangenen Jahr haben die Verkehrsminister:innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz das gemeinsame Positionspapier „Die DAK kommt!“ unterzeichnet und sich damt zu einer möglichst raschen Einführung und gemeinsamen Finanzierung der DAK im Schienengüterverkehr bekannt. Die DAK soll durch deutliche Steigerungen der Kapazität, Produktivität, Qualität sowie der Sicherheit den europäischen Schienengüterverkehr ins 21. Jahrhundert führen.
Derzeit laufen umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf europäischer wie auf nationaler Ebene, um die Serienreife der DAK zu erlangen. Sie soll die herkömmliche Schraubenkupplung in Europa im europäischen Rahmen ab 2026 schrittweise in mehreren Migrationsstufen flächendeckend ablösen. Neben bisherigen Testzügen soll die DAK in Demonstratoren ab 2026 implementiert werden, um fortführend die Grundlage für die sog. Phase des Pre-Deployment bilden. Europaweit sollen in dieser Phase an die 100 DAK-Pilotzüge verkehren um europaweit wichtige Erkenntnisse zu regional spezifischen und technischen Herausforderungen sowie zu unterschiedlichen betrieblichen Szenarien und vor allem Zuverlässigkeit des Systems zu sammeln; bis das System bis 2030+ ausgerollt ist.