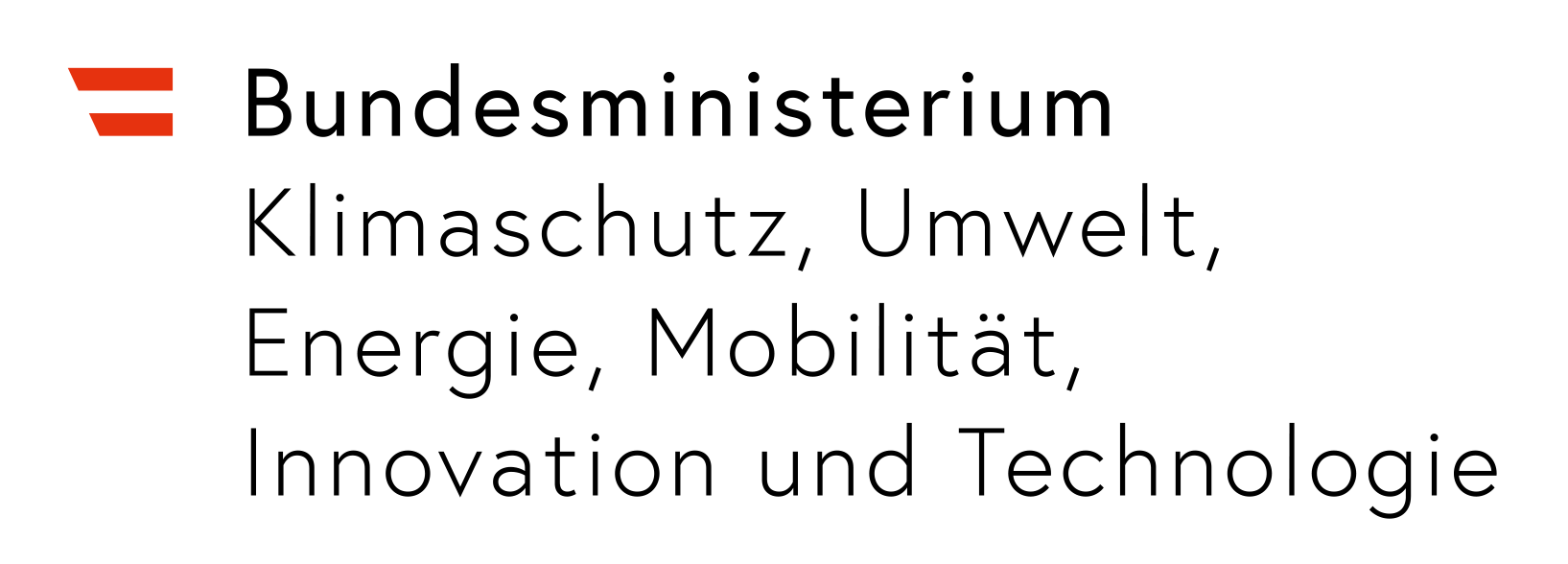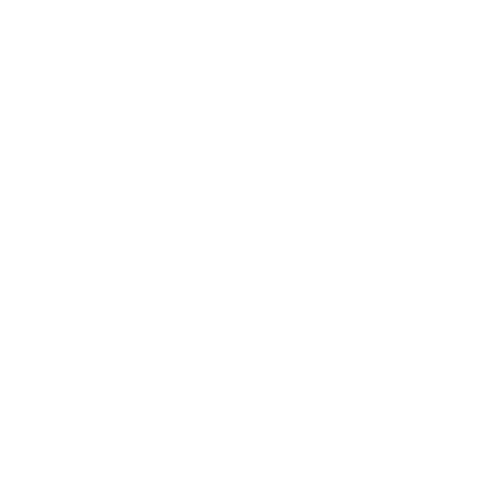Kategorie Mobilität - 6. Mai 2025
Österreich ist beim Bahnfahren wieder Nummer 1 in der EU
Bahnfahren ist in Österreich zunehmend populär. Mit 1.597 je Einwohnerin und Einwohner gefahrenen Bahnkilometern im Jahr 2023 rangiert Österreich vor Frankreich (1.542 km) und Schweden (1.261 km) im EU-Vergleich auf Platz eins, zeigt ein Bericht des Dachverbands europäischer Eisenbahnregulierungsbehörden (IRG-Rail). Damit wurde der Bestwert aus dem Jahr 2019 (1.507 km) übertroffen. Europaweit hat die Schweiz mit 2.487 Bahnkilometern pro Kopf die Nase vorne.
Insgesamt stieg die Anzahl der Personenkilometer in Österreich wie im Durchschnitt der 31 untersuchten europäischen Länder um zwölf Prozent. Der Trend zur nachhaltigen Mobilität dürfte sich fortsetzen. So gaben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) erst kürzlich bekannt, im Jahr 2024 erstmals über eine halbe Milliarde Fahrgäste transportiert zu haben. Rund 300 Millionen davon entfallen auf den Schienenverkehr.
Damit die Bahn diesen Entwicklungen auch künftig gerecht wird, heißt es für die ÖBB weiterhin: fleißig investieren. Mit den beschlossenen Investitionen von 21,1 Milliarden Euro für den ÖBB-Rahmenplan im Zeitraum 2024 – 2029 sichert das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) den eingeschlagenen Investitionskurs in klimafreundliche Mobilität nachhaltig ab.
Die ÖBB investieren jedoch nicht nur in das Streckennetz und neue Technologien, sondern erneuern aktuell auch die bestehenden Garnituren ihrer wohl bekanntesten Züge: der Railjets. Nach mehr als 15 Jahren auf Schiene haben die Railjets der Bestandsflotte die Hälfte ihrer geplanten 30-jährigen Einsatzzeit erreicht. Nun werden sie schrittweise in den Bereichen Technik und Komfort modernisiert, um Fahrgästen auch in Zukunft den höchsten Fahrkomfort zu bieten. Ende 2031 sollen alle 60 Bestands-Garnituren upgegradet werden und an den Qualitätsstandard des Railjet der neuen Generation angepasst sein. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 wird bereits die erste Garnitur erneuert und bereit für ihren ersten Einsatz auf der Südstrecke sein. Die Fahrzeuge werden, wie auch bisher, auf den Railjet-Strecken in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, der Slowakei, Tschechien und Italien eingesetzt werden.
- Modernisierte Sitze in der 2. Klasse des Railjets. © ÖBB
- Modernisierte Sitze in der 1. Klasse des Railjets. © ÖBB
Modernisierungen, technologischer Fortschritt und mit dem Klimaticket eine leistbare Jahreskarte für ganz Österreich waren Faktoren, die mehr Menschen zur Bahn umsteigen ließen. Hinzu kamen zuletzt aber auch Ereignisse wie die Coronapandemie und der damit verbundenen Trend zum Homeoffice, der zu nachhaltigen Veränderungen in der Mobilität der Menschen und im Bahnverkehr im Speziellen führte. „Wenn früher der Freitag meist die Rückreisezeit von Wien in die Bundesländer war, ist es jetzt eher schon der Donnerstag. Ähnliches gilt umgekehrt für Sonntag und Montag“, so Frank Michelberger, Leiter des Departments Bahntechnologie und Mobilität der FH St. Pölten. Diese gesteigerte Flexibilität im Arbeitsalltag sei für die Auslastungen der Bahn ein positiver Faktor. Österreich liegt aber nicht nur beim Bahnfahren an der Spitze der EU-Staaten, sondern ist laut Expertinnen und Experten auch bei Forschung und Entwicklung im Schienenfahrzeugbau sehr gut aufgestellt.
So soll das heimische Leuchtturm-Projekt „Rail4Future“ den Weg zu einem vollständig vernetzten und digitalisierten Bahnsystem ebnen. Dabei wurde eine Streckensimulation entwickelt, die Interaktionen der Schienenfahrzeuge mit der Trasse, einzelnen Brücken, Tunnels und Weichen im Modell abbildet, erläuterte Manfred Grafinger vom Forschungsbereich Maschinenbauinformatik und Virtuelle Produktentwicklung an der Technischen Universität (TU) Wien. Konkret können auf der Plattform nun verschiedenste Zugkombinationen virtuell auf die Strecke geschickt werden, um die Belastungen der nächsten Monate und Jahre zu simulieren.
Im digitalen Abbild lässt sich der Zustand über Ampelfarben anzeigen, eine grün eingefärbte Komponente ist dementsprechend also in Ordnung. „Wenn man den Zeitschieber vorwärts stellt, kann man beobachten, wann sie schließlich gelb wird und Wartungsarbeiten anstehen, damit sich der Zustand hoffentlich niemals rot einfärbt“, so Stefan Marschnig vom Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrswirtschaft der TU Graz. Daraus lasse sich auch ableiten, wie die Infrastruktur mit erhöhten Frequenzen und Belastungen zurechtkommt, um eine weitere Verdichtung des Zugverkehrs zu erreichen und schlussendlich mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bekommen.
Erstmals über eine halbe Milliarde: ÖBB-Fahrgastzahlen 2024 erneut gestiegen